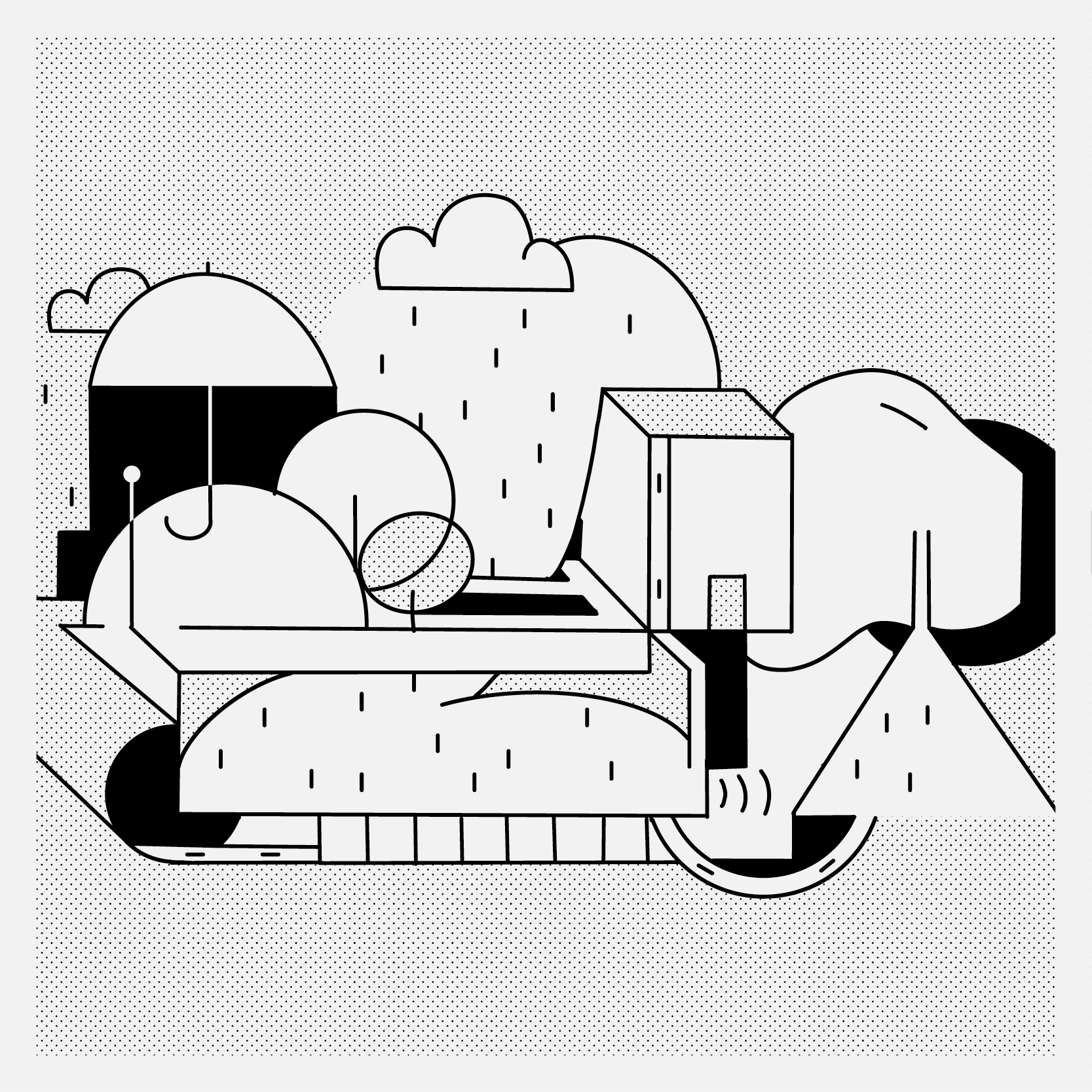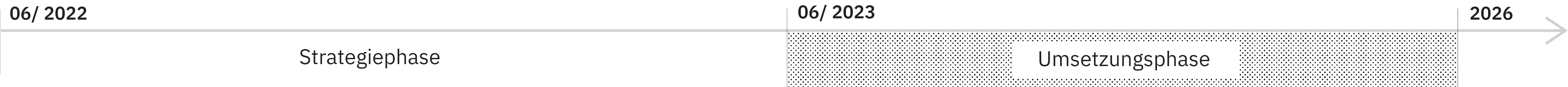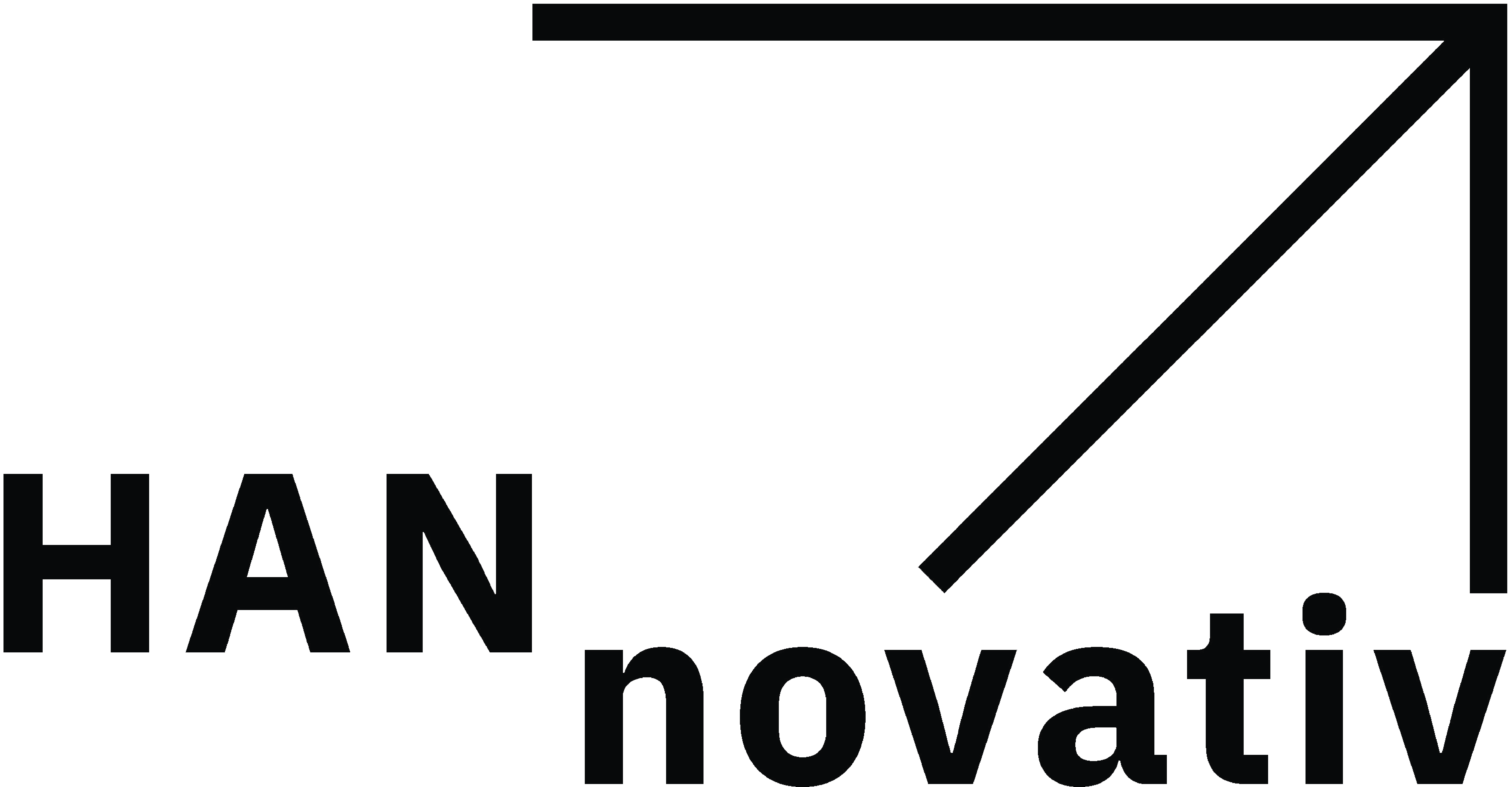Hitze.Wasser.Management
Ziel
Automatische Bewässerung und Pflege städtischer Grünflächen.
Herausforderungen
Zunehmende Hitzeperioden, abnehmender Niederschlag, steigende Kosten für die Bewässerung der Grünflächen und Pflanzen in der Stadt.
Lösung
Es werden unterirdische Regentonnen (Zisternen) zum Auffangen von Regenwasser installiert. Bäume werden mit Bodenfeuchte-Sensoren ausgestattet, um sie bei Bedarf automatisch aus den Zisternen mit Regenwasser zu bewässern. Im Bereich der Innenstadt sorgen modellgesteuerte, sprühende Wasserelemente (sogenannte Brumisateure) bedarfsgerecht für Verdunstungskühlung. Sensoren des Klimamessnetzes, die Lufttemperatur, Luftfeuchte und gefühlte Temperatur messen (s. auch Klima.Agenten.Modell), liefern die erforderlichen Steuerungsdaten.
Das Auffangen von Starkregen sorgt für Einsparung im Wasserverbrauch und schont das Grundwasser. Zeit- und Personalaufwand für die Bewässerung kann reduziert werden. Aufgeheizte Räume in der Innenstadt werden durch das Versprühen von Regenwasser herunter gekühlt. Außerdem werden die Kosten und der Aufwand für die Bewässerung reduziert. Innerstädtische Räume werden als Aufenthalts- und Begegnungsorte attraktiver, wenn es Schutz vor Sonne (Bäume) und Hitze (Brumisateure) gibt. Der Grundwasserverbrauch wird durch die Nutzung von Regenwasser verringert und das Auffangen des Starkregens puffert negative Effekte (z.B. Überschwemmungen, Überlastung der Kanalisation) ab.